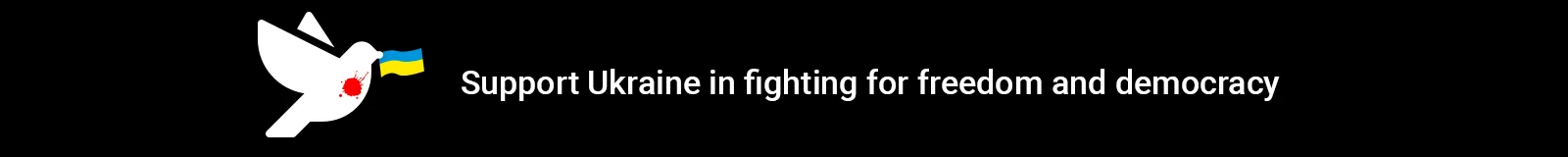



Silbergrüne bläuling
Der Silbergrüne Bläuling (Lysandra coridon, Syn. Polyommatus coridon) ist ein Schmetterling (Tagfalter) aus der Familie der Bläulinge (Lycaenidae). Das Artepitheton leitet sich von Corydon, einem griechischen Hirtennamen ab. Die Art besiedelt trockene und sonnige, schwach bewachsene Habitate und kommt trotz des Rückgangs solcher Lebensräume meist noch häufig und in großen Individuenzahlen vor. Wie bei vielen Bläulingen leben auch die Raupen des Silbergrünen Bläulings in Symbiose mit Ameisen. Der Silbergrüne Bläuling war das Insekt des Jahres 2015.





Die Tiere kommen vom Norden und Osten Spaniens über Mittel- und Südeuropa (Mittelitalien, Korsika, Balkan) östlich bis in die Ukraine und zum Ural und die Steppen nördlich des Kaspischen Meeres vor. Sie erreicht Mittelgriechenland, fehlt aber in der Türkei. Nördlich erstreckt sich das Verbreitungsgebiet über den Süden Englands, Norddeutschland und den Großteil des Baltikums. In Deutschland kommt die Art im südlichen Bergland und in den Alpen relativ häufig vor, im Norden ist sie selten. Die früher in Österreich im Alpengebiet oder auch im Alpenvorland oft sehr häufige Art ist seit langem in Regression. Die Tiere leben auf Kalktrockenrasen und an anderen trockenen, sonnigen und temperaturbegünstigten, nur mit vereinzelten Büschen und kurzen Gräsern bewachsenen Bereichen, ausschließlich auf kalkhaltigen, alkalischen Böden.

Die Imagines saugen Nektar vor allem von Lippenblütlern der Gattung Oregano (Origanum vulgare). Fehlen diese Pflanzen, wird Gewöhnlicher Hornklee (Lotus corniculatus) bevorzugt, man findet die Tiere aber auch an Tauben-Skabiose (Scabiosa columbaria), Wiesen- (Centaurea jacea), Skabiosen-Flockenblume (Centaurea scabiosa) und zumindest gelegentlich auch an den übrigen im Lebensraum vorhandenen Blüten. Hülsenfrüchtler spielen anders als bei anderen Bläulingsarten nur eine unbedeutende Rolle als Nektarpflanzen. Häufig findet man die Falter auch auf Kies, wo sie an feuchten Stellen saugen. Sie treten meist in größeren Gruppen auf. Abends sammeln sie sich, um an leicht erhöhten Standorten, wie beispielsweise an die Vegetation etwas überragenden Doldenblütlern kopfabwärts zu schlafen.
Die Weibchen legen ihre weißlichen Eier einzeln an der Basis der Stängel, den Blattachseln und nur selten an den Blättern der Raupennahrungspflanzen ab. Mitunter werden sie auch an nahe gelegenen Gräsern und Steinen abgelegt. Die Weibchen fliegen dabei flach über die Vegetation und landen etwas entfernt an einer unbewachsenen Stelle, um den Rest des Weges zum Eiablageplatz zu Fuß zurückzulegen. Die Vegetation wird dabei betrommelt, nach Berührung der Raupennahrungspflanzen wird der Hinterleib zur Eiablage gekrümmt. Nachdem einige Eier abgesetzt wurden, wird zwischenzeitlich Nektar gesogen.
Die Eier überwintern, die Raupen schlüpfen erst im darauffolgenden Frühjahr. Lediglich in Griechenland überwintert die Raupe bereits nach der ersten Häutung unter Steinen in der Nähe von Ameisennestern. Die Raupen leben myrmekophil zusammen mit Ameisen. Symbiosen sind mit einigen Wegameisen- (Lasius) und Myrmica-Arten, mit Plagiolepis vindobonensis, mit der Gemeinen Rasenameise (Tetramorium caespitum) und mit der Roten Waldameise (Formica rufa) bekannt. Die Raupen sondern über Drüsen Lockstoffe aus, die die Ameisen anlocken. Auch sondern sie bei Berührung durch Ameisenfühler durch einen Spalt am Rücken des siebten Hinterleibssegmentes ein süßes Sekret ab, das die Ameisen fressen. Am achten Hinterleibssegment befinden sich zwei vorstülpbare Fortsätze, die am Ende einen Kranz aus Häkchen tragen. Diese beiden Organe werden besonders dann bewegt, wenn Ameisen in der Nähe sind und sollen sie vermutlich ebenso anlocken. Neben dem Schutz vor Fressfeinden bauen die Ameisen mitunter „Unterstände“ aus lockerem Erdreich für die Raupen, die auch Verbindungen zu nahen Ameisennester aufweisen können.
Die dämmerungs- und nachtaktiven Raupen sitzen tagsüber in Gruppen im Geröll oder Moos unter den Nahrungspflanzen. Diese Pflanzen kann man dann an den vielen Ameisen auf den niedrig liegenden Trieben erkennen. Die Verpuppung erfolgt unter Steinen, die Puppe ist glatt und olivgrün.
In Deutschland ist der Silbergrüne Bläuling vielerorts noch häufig zu finden, obwohl sein Lebensraum zunehmend zerstört wird. Da die Art, im Gegensatz zum deutlich sensibleren Himmelblauen Bläuling (Polyommatus bellargus), toleranter gegenüber Eingriffen ist und beispielsweise auch an Böschungen, Wegrändern und Bahndämmen vorkommt, ist ihr Bestand nicht gefährdet; die Art wird in der Roten Liste Deutschlands nicht geführt. Allerdings ist sie in mehreren nördlichen Bundesländern gefährdet, in Niedersachsen ist sie stark gefährdet (Kategorie: 2), in Sachsen sogar vom Aussterben bedroht.In Österreich ist die Art in Regression.